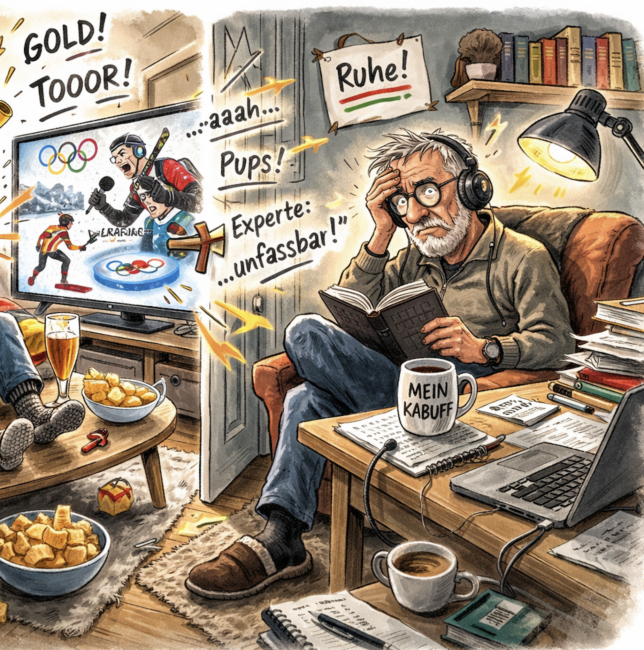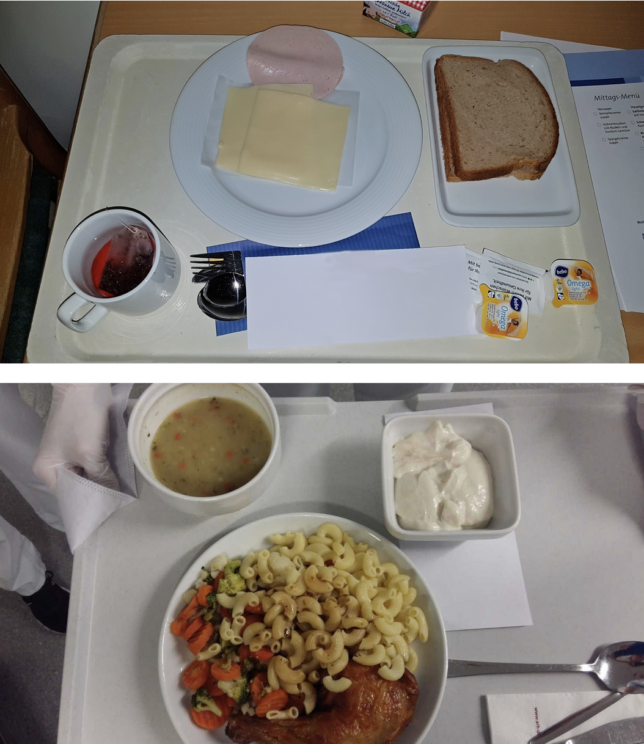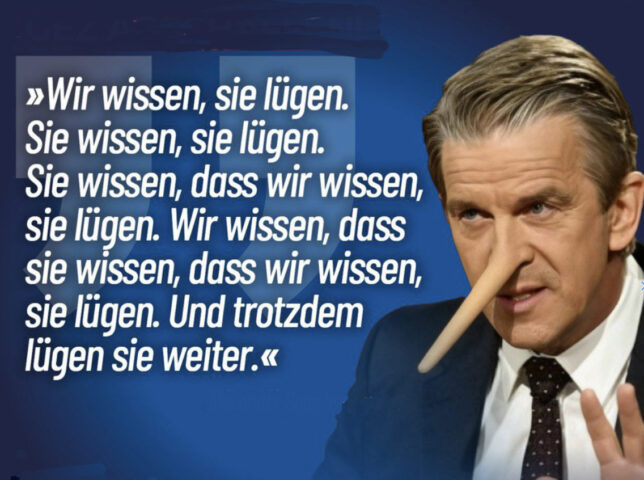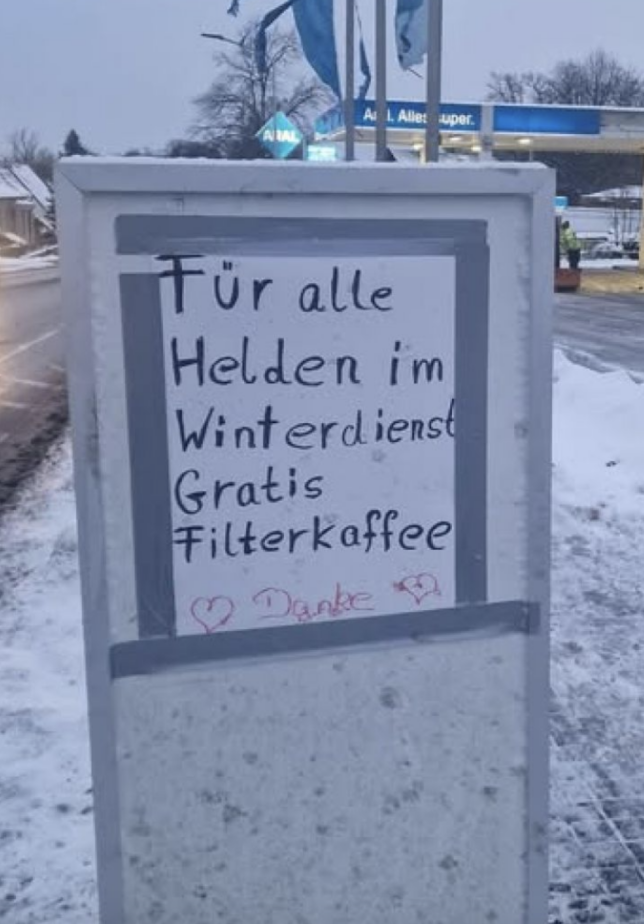Franken gegen Franken: Identitätskrise wegen Hymnenstrophen.
„Seit über 150 Jahren wird es gesungen, das Frankenlied, und gilt als inoffizielle Hymne aller Franken. Eigentlich. Doch jetzt ist den Mittelfranken aufgefallen, dass sie in keiner Zeile erwähnt werden. Deshalb will der Bezirk eine weitere, explizit mittelfränkische Strophe hinzudichten lassen und hat dafür einen Wettbewerb ausgerufen. Das stößt aber den Oberfranken auf, spiele doch das Frankenlied bei ihnen und lasse sich nicht mal eben „im Vorbeigehen“ verändern. Tiefe Gräben tun sich auf …“: sogar das Fernsehen hat sich des Themas angenommen: in der Sendung „Quer“ des BR vom 26. Februar 2026.
https://www.ardmediathek.de/video/quer-mit-christoph-suess/franken-gegen-franken-identitaetskrise-wegen-hymnenstrophe/br/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdC9GMjAyNVdPMDIyMjY5QTAvc2VjdGlvbi84OTk3ZDU3MC0xODExLTQzY2ItYmQ3Ny02ZTZkNDg1NTY4MGY
Ein Landrat (Lichtenfels) und ein Bezirkstagspräsident (Mfr.) sind in diesem Kulturkampf mit von der Partie.

Fast jeder echte Franke kennt wenigstens einige „Gsetzla“ der Hymne. Söder kennt nur „Valeri und valera …!“
In der vierten Strophe wird Bamberg, der Hl. Veit von Staffelstein und der Grabfeldgau besungen. Natürlich immer wieder der Main und der Wein. Bamberg und Staffelstein für Oberfranken; Grabfeldgau und Wein für Unterfranken.
Aber nix von Bratwurst, Christkindlasmarkt und Schäuferla.
Sowas gehd goar ned!
Hier ein Vorschlag für eine Mittelfrankenstrophe:
Vom Pegnitzstrand, zur Altmühl hin,
wo Nürnbergs Zinnen stehen,
da klingt der Sang durch Stadt und Flur,
so stolz und wunderschön.
Wo Schäuferla bruzzelt, Bratwurst glüht,
Und laben uns bei Bier und Wein —
Wo Söder ruft: „Mein Frankenland,
Mittelfranken soll es sein!“
Es gibt historisch schon verbürgte Ergänzungsstrophen zu Viktor von Scheffels Versen, die uns Franken wohl gefallen sollten – über jeden Streit hinweg (Quelle: Wikipedia):
7. Strophe
O heil’ger Veit von Staffelstein,
beschütze unser Franken
und jag’ die Bayern aus dem Land!
Wir wollen’s ewig danken.
Wir wollen freie Franken sein
und nicht der Bayern Knechte.
O heil’ger Veit von Staffelstein,
wir fordern uns’re Rechte!8. Strophe
Napoleon gab als Judaslohn
– ohn’ selbst es zu besitzen –
ganz Franken und die Königskron’
den bayrischen Komplizen.
Die haben fröhlich dann geklaut
uns Kunst, Kultur und Steuern,
und damit München aufgebaut.
Wir müssen sie bald feuern!9. Strophe
Drum, heil’ger Veit von Staffelstein,
Du Retter aller Franken:
Bewahre uns vor Not und Pein,
weis’ Bayern in die Schranken!
Wir woll’n nicht mehr geduldig sein,
denn nach zweihundert Jahren,
woll’n wir – es muss doch möglich sein –
durch’s freie Franken fahren!
Ich will aber Bengatz (Pegnitz), meinen Heimatort nicht vergessen, hat doch V. von Scheffel ihn auch nicht ausdrücklich erwähnt.
Vielleicht wird dann diese Strophe beim nächsten „Flinderer“ oder „Bratwurstgipfel“ in Pegnitz gesungen:
Zur Bengatz hin, zum kleinen Kulm,
wo dunkle Wälder stehn,
da klingt das Lied von Bier und Brot
so stolz und wunderschön.
Wo frische Schipf und kühles Bier
uns laben stark und gut —
Bengatz ist mein Heimatland,
dir gilt mein Sang voll Glut!Valeri, valera …
Zum Mitsingen ( ab 1:16):